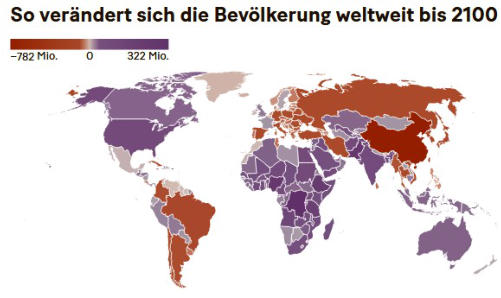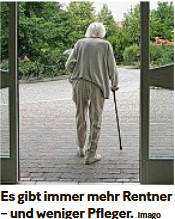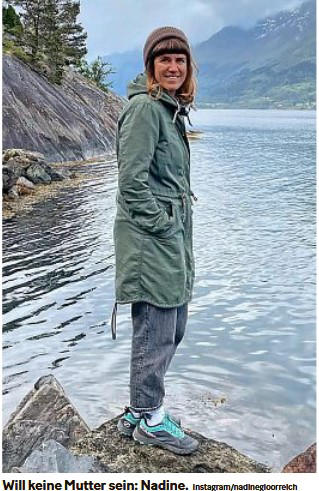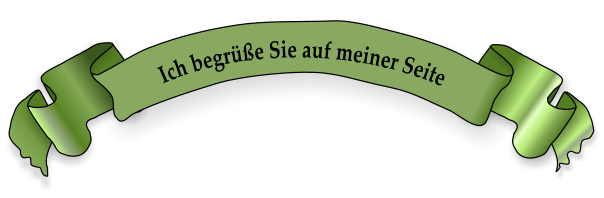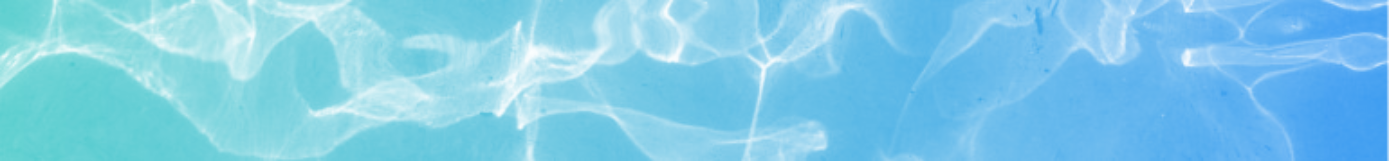


Mediathek dein Heimatsender
Herzlich Willkommen
henry-aurich.de


«Zeitalter der Entvölkerung»: Geburtenraten sinken weltweit
ZÜRICH Die Welt steht vor einer historischen Wende: Statt weiter zu wachsen, beginnt die globale Bevölkerung zu schrumpfen.
Lange galt die Überbevölkerung als die grosse
Zukunftsangst. In den 1960er-Jahren lebten rund 3,5
Milliarden Menschen auf der Erde – 2024 sind es bereits
über 8 Milliarden. Doch das Wachstum flacht ab: Laut
einer UN-Prognose erreicht die Menschheit um das Jahr
2080 mit etwa 10,2 Milliarden Menschen ihren Höhepunkt
– und schrumpft danach allmählich. In der Schweiz geht
die durchschnittliche Anzahl Kinder pro Frau seit 2021
kontinuierlich zurück – 2024 lag sie laut dem Bundesamt
für Statistik bei 1,29. Der US-Demograf und Ökonom
Nicholas Eberstadt spricht im Magazin «Foreign Affairs»
vom «Zeitalter der Entvölkerung» und dem Beginn eines
neuen Zeitalters: «Was vor uns liegt, ist eine Welt der
schrumpfenden und alternden Gesellschaften.»
China schrumpft am meisten In den nächsten Jahrzehnten
könnten sich einige Regionen entvölkern, andere wachsen
rasant. China wird um rund 782 Millionen Menschen
schrumpfen – das ist der mit Abstand grösste
demografische Verlust weltweit. Auch in Europa, Japan,
Südkorea und Teilen Südamerikas wird die
Einwohnerzahl deutlich sinken. Dafür wird Afrika gemäss
der Prognose massiv wachsen. In Ländern wie Nigeria,
der Demokratischen Republik Kongo oder Äthiopien wird
ein Zuwachs von über 100 Millionen Menschen
prognostiziert.
Bis 2100 könnte der Kontinent Europa 152 Millionen
Menschen verlieren – selbst mit positiver
Nettozuwanderung. Ohne Migration wäre der Rückgang
noch drastischer: Die europäische Bevölkerung würde auf
unter 300 Millionen sinken. Besonders betroffen sind
Polen, Italien, die Ukraine und Spanien. Der Grund sind
sinkende Geburtenraten – schneller und tiefer, als viele
Forschende erwartet haben. Die weltweite Geburtenrate
lag im vergangenen Jahr im Durchschnitt bei 2,2 Kindern
pro Frau und fällt laut Prognose bis 2100 auf 1,8 –
deutlich unter dem Bestandserhaltungsniveau von 2,1, das nötig wäre, um eine stabile Bevölkerungszahl zu halten.
Durchschnittsalter steigt Parallel steigt das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung:War die Bevölkerung 1950 noch durchschnittlich 22 Jahre alt, wird sie 2100 voraussichtlich über 42
Jahre alt sein.
THOMAS SENNHAUSER/TOM VAILLANT
Wie Länder Gegensteuer geben
ZÜRICH Was unternehmen Länder angesichts sinkender Geburtenraten? In der Schweiz sind 14 Wochen Mutterschaftsurlaub gesetzlich vorgeschrieben. Ein gesetzlicher Vaterschaftsurlaub wurde 2020
eingeführt und beträgt zwei Wochen. Ausserdem gibt es steuerliche Entlastungen für Familien, und die Kinderbetreuung ist teilweise subventioniert – bleibt aber oft teuer.
Studien – etwa vom Forschungsinstitut Sotomo oder der Universität Zürich – zeigen, dass viele Eltern sich mehr Kinder wünschen, aber sich aus finanziellen oder organisatorischen Gründen dagegen
entscheiden. Besonders in Städten wie Zürich oder Genf gelten hohe Wohnund Betreuungskosten als klare Hürde. Obwohl es vereinzelt Bestrebungen für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt,
bleibt die Wirkung begrenzt. Ein national abgestimmtes Familienfördermodell fehle bislang – was die Schweiz laut Demografieexperten wie François Höpflinger im europäischen Vergleich als «zögerlich»
dastehen lässt.
Frankreich andererseits kombiniert hohes Kindergeld, Wohnhilfen, steuerliche Vorteile und flächendeckende Kinderbetreuung. Das Ergebnis: Mit rund 1,6 Kindern pro Frau hat Frankreich eine der
höchsten Geburtenraten Europas. Experten sehen darin ein wirkungsvoll abgestimmtes Gesamtsystem. THS
Warum wir weniger Kinder kriegen – und die Folgen davon
ZÜRICH Die Menschheit erlebt einen tiefgreifenden Wandel, der sich nicht mit einem Schlag, sondern still und schleichend vollzieht: Die Bevölkerung
wird ab 2080 schrumpfen (siehe links). Ein breiter Konsens unter Demografen und Soziologen lautet: Der Kinderwunsch ist nicht verschwunden – aber
schwieriger umzusetzen. Das sind die Gründe dafür:
Bildung und emanzipation Wie Studien der Vereinten Nationen und der Weltbankzeigen, ist, je höher der Bildungsgrad der Frauen, desto niedriger
die Geburtenrate.
Kosten und Unsicherheit Laut einer Studie des US Census Bureau von 2024 schrecken steigende Wohnkosten, prekäre Arbeitsverhältnisse und hohe
Studiengebühren viele Paare ab.
Verhütung und Religion Verhütungsmittel sind weltweit verfügbar. Der Einfluss von Religion auf die Familienplanung sinkt.
Gesellschaftliche Vorbilder Popkultur beeinflusst Rollenbilder. Immer mehr prominente Frauen propagieren ein Leben ohne Kinder. Der diesjährige Bericht des
Forschungsinstituts Bruegel zeigt die Folgen auf:
Rentenkrise In vielen Ländern zahlen die Berufstätigen mit ihren Beiträgen die Renten der älteren Generation. Aber es gibt immer weniger junge Menschen und immer mehr
Rentner. Das bringt das System ins Wanken.
Pflegekrise Mit dem demografischen Wandel wächst nicht nur die Zahl pflegebedürftiger älterer Menschen – gleichzeitig sinkt das Angebot an Pflegekräften rapide.
Arbeitsmarkt Unternehmen finden kaum Nachwuchs. Das betrifft Industrie, Handwerk, Pflege, Bildung und IT. Machtverschiebung Während in Europa die Gesellschaften
altern und schrumpfen, wächst in Afrika eine junge, dynamische Bevölkerung heran. Afrika hat mit rund 19 Jahren das jüngste Durchschnittsalter weltweit – in Europa liegt es bei
fast 45 Jahren. THS
Keine Kinder – oder dann so viele wie möglich
WETZIKON Nadine (36) aus Wetzikon ZH hat sich bewusst gegen Kinder entschieden. Die Zürcherin verweist auf strukturelle Ungleichheiten: «Mütter
sind häufig finanziell abhängig, übernehmen den Grossteil der Mental Load und werden in der Altersvorsorge massiv
benachteiligt.» Auch der soziale Druck sei hoch: «Wer als Mutter viel arbeitet, gilt schnell als Rabenmutter. Wer
wenig arbeitet, hat später kaum Rente.» Sie sagt: «Ich bin froh, diese Rolle nicht einnehmen zu müssen. Frau sein
reicht völlig aus.» Über ihren Blog sei sie mit vielen Gleichgesinnten in Kontakt gekommen.
Andere dagegen wollen besonders viele Kinder. Malcolm und Simone Collins etwa haben vier Kinder
– das fünfte ist unterwegs. Das US-Paar nennt sich im «Tages-Anzeiger» selbst «Pronatalisten»
und wählt bei künstlicher Befruchtung gezielt Embryonen mit hohem IQ-Potenzial und nach
Geschlecht aus. Ihr Ziel: mit möglichst vielen «optimierten» Kindern gegen den Geburtenrückgang
ankämpfen.
Nadine sieht Entwicklungen wie diese kritisch: «Was mich stört, ist, wenn der Geburtenrückgang
dramatisiert wird – und gleichzeitig Migration als Überforderung gilt. Im Grunde geht es oft
nicht um mehr Kinder, sondern um die richtigen.» Gerade in pronatalistischen Kreisen stecke
häufig der Wunsch nach möglichst weissen, leistungsfähigen Nachkommen, so die 36-Jährige.
Käthi
Kaufmann (53), Mutter von fünf Kindern und
Präsidentin der
IG Familie 3plus, einer Gemeinschaft von Schweizer
Grossfamilien,
findet dagegen: Kinderreiche Familien erlebten oft
Vorurteile –
von «überfordert» bis «asozial». Dabei, so Kaufmann,
lebten viele
solidarischer und ressourcenschonender, als ihr Ruf
es vermuten
lasse. THS